KI-Tool Expert (IHK) Berufsbegleitender Onlinekurs Start: 16.05.2025
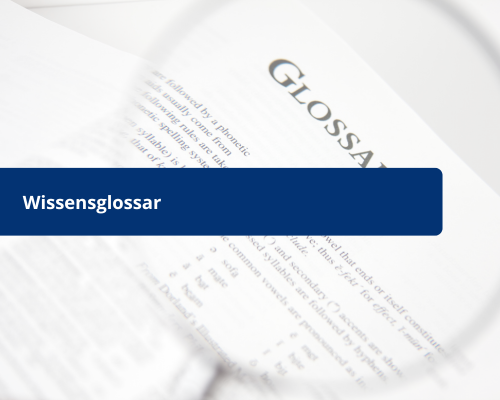 Ein gemeinsames Wissensglossar entwickeln
Ein gemeinsames Wissensglossar entwickeln
Ob in der Wissenschaft, Technik oder im beruflichen Alltag – Fachbegriffe helfen dabei, komplexe Sachverhalte zu strukturieren und Missverständnisse zu vermeiden. Gerade wenn wir mit neuen Themen oder Disziplinen in Berührung kommen, ist es wichtig, unbekannte Begriffe gezielt zu definieren.
Durch das Erstellen eines gemeinsamen Wissensglossars tragen wir dazu bei, unser Verständnis zu vertiefen und unser Wissen strukturiert zu erweitern. Indem wir einen Fachbegriff, den wir zuvor noch nicht kannten, recherchieren und definieren, fördern wir nicht nur unser eigenes Lernen, sondern ermöglichen es auch anderen, von unserem Wissen zu profitieren.
Aufgabe: Erstellt einen Eintrag im Wissensglossar, indem ihr einen ausgewählten Fachbegriff passend zum aktuellen Modul definiert. Bitte gebt am Ende eure Quellen an.
Grundlage für diese Aufgabe ist die Dozentenpräsentation, welche ihr in den "Materialien zu Modul 6" findet. Bitte beachtet bei der Bearbeitung der Aufgabe zudem die Mindest- bzw. Höchstwortanzahl: mindestens 200 Wörter, höchstens 400 Wörter.
Feedback: In dieser Aufgabe ist kein Peer-Feedback erforderlich.
@ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alle
A |
|---|
Anomalie-Erkennung / Anomaly DetectionAnomalie-Erkennung (engl. Anomaly Detection) Die Anomalie-Erkennung ist ein wichtiger Teilbereich der Künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens, der sich mit der automatisierten Identifikation ungewöhnlicher oder abweichender Muster in Daten beschäftigt. Eine Anomalie bezeichnet dabei Datenpunkte oder Verhaltensweisen, die signifikant von der Norm abweichen. Solche Abweichungen können Hinweise auf Fehler, Betrug, Sicherheitsverletzungen, technische Defekte oder seltene Ereignisse sein. Im Gegensatz zu klassischen Klassifikationsproblemen, bei denen alle Kategorien bekannt sind, ist die Anomalie-Erkennung oft eine Herausforderung, weil Anomalien selten und vielfältig sein können. Deshalb werden häufig unüberwachte oder halbüberwachte Lernmethoden eingesetzt, bei denen das Modell nur mit „normalen“ Daten trainiert wird und danach ungewöhnliche Daten als Anomalien identifiziert. Typische Verfahren sind statistische Methoden, Clustering, neuronale Netze oder spezielle Algorithmen wie Autoencoder und Isolation Forest. Anwendungsbeispiele finden sich in vielen Bereichen:
Durch den Einsatz von KI-gestützter Anomalie-Erkennung können Unternehmen schneller reagieren, Risiken minimieren und Kosten sparen. Allerdings sind die Algorithmen nur so gut wie die Trainingsdaten und benötigen oft eine sorgfältige Anpassung und Überwachung, um Fehlalarme zu reduzieren. Quellen:
| ||
API (Application Programming Interface)Eine API, kurz für „Application Programming Interface“ (Programmierschnittstelle), ist eine definierte Schnittstelle, über die Softwareanwendungen miteinander kommunizieren können. Sie stellt eine Sammlung von Funktionen, Protokollen und Definitionen bereit, die es ermöglichen, bestimmte Dienste, Daten oder Funktionen einer Anwendung oder eines Systems von einer anderen Anwendung aus anzusteuern oder zu nutzen – ohne dass dabei deren interne Implementierungsdetails bekannt sein müssen. APIs fördern damit die Interoperabilität und Modularität von Softwarelösungen und sind ein zentrales Element moderner Softwareentwicklung. APIs existieren in unterschiedlichen Formen, etwa als Betriebssystem-APIs (z. B. Windows API), als Bibliotheks-APIs oder als Web-APIs, die insbesondere in cloudbasierten und serviceorientierten Architekturen eine zentrale Rolle spielen. Letztere nutzen in der Regel standardisierte Kommunikationsprotokolle wie HTTP und Datenformate wie JSON oder XML, um über das Internet oder interne Netzwerke Daten zwischen Clients und Servern auszutauschen. Web-APIs sind insbesondere in RESTful- oder SOAP-Strukturen organisiert und ermöglichen beispielsweise den Zugriff auf Funktionen von Online-Plattformen wie Zahlungsdiensten, sozialen Netzwerken oder Wetterdiensten. Die Nutzung von APIs bringt zahlreiche Vorteile mit sich: Sie erleichtert die Integration externer Dienste, verkürzt Entwicklungszeiten und fördert die Wiederverwendbarkeit von Softwarekomponenten. Gleichzeitig stellt der Einsatz von APIs auch Anforderungen an Sicherheit und Datenschutz, etwa durch Authentifizierungsmechanismen (z. B. OAuth) oder Zugriffsbeschränkungen. APIs sind in der heutigen digitalen Welt nahezu allgegenwärtig – von mobilen Apps über Unternehmensanwendungen bis hin zum Internet der Dinge (IoT). Durch die gezielte Offenlegung von APIs können Unternehmen zudem sogenannte „Open APIs“ bereitstellen, die es externen Entwicklern ermöglichen, eigene Anwendungen auf Basis der bereitgestellten Schnittstellen zu entwickeln und so das eigene Ökosystem zu erweitern. Quelle: OpenAPI Initiative. (n.d.). What is an API?. https://www.openapis.org/what-is-an-api | |
