KI-Tool Expert (IHK) Berufsbegleitender Onlinekurs Start: 16.05.2025
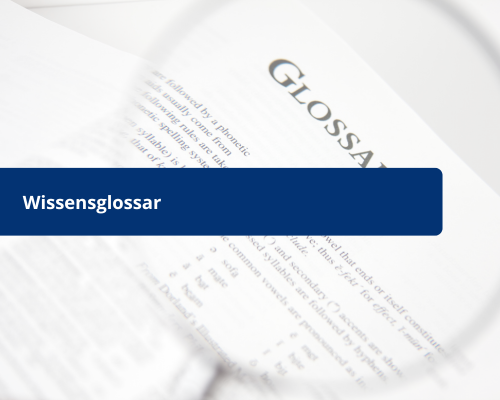 Ein gemeinsames Wissensglossar entwickeln
Ein gemeinsames Wissensglossar entwickeln
Ob in der Wissenschaft, Technik oder im beruflichen Alltag – Fachbegriffe helfen dabei, komplexe Sachverhalte zu strukturieren und Missverständnisse zu vermeiden. Gerade wenn wir mit neuen Themen oder Disziplinen in Berührung kommen, ist es wichtig, unbekannte Begriffe gezielt zu definieren.
Durch das Erstellen eines gemeinsamen Wissensglossars tragen wir dazu bei, unser Verständnis zu vertiefen und unser Wissen strukturiert zu erweitern. Indem wir einen Fachbegriff, den wir zuvor noch nicht kannten, recherchieren und definieren, fördern wir nicht nur unser eigenes Lernen, sondern ermöglichen es auch anderen, von unserem Wissen zu profitieren.
Aufgabe: Erstellt einen Eintrag im Wissensglossar, indem ihr einen ausgewählten Fachbegriff passend zum aktuellen Modul definiert. Bitte gebt am Ende eure Quellen an.
Grundlage für diese Aufgabe ist die Dozentenpräsentation, welche ihr in den "Materialien zu Modul 6" findet. Bitte beachtet bei der Bearbeitung der Aufgabe zudem die Mindest- bzw. Höchstwortanzahl: mindestens 200 Wörter, höchstens 400 Wörter.
Feedback: In dieser Aufgabe ist kein Peer-Feedback erforderlich.
@ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Alle
A |
|---|
Anomalie-Erkennung / Anomaly DetectionAnomalie-Erkennung (engl. Anomaly Detection) Die Anomalie-Erkennung ist ein wichtiger Teilbereich der Künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens, der sich mit der automatisierten Identifikation ungewöhnlicher oder abweichender Muster in Daten beschäftigt. Eine Anomalie bezeichnet dabei Datenpunkte oder Verhaltensweisen, die signifikant von der Norm abweichen. Solche Abweichungen können Hinweise auf Fehler, Betrug, Sicherheitsverletzungen, technische Defekte oder seltene Ereignisse sein. Im Gegensatz zu klassischen Klassifikationsproblemen, bei denen alle Kategorien bekannt sind, ist die Anomalie-Erkennung oft eine Herausforderung, weil Anomalien selten und vielfältig sein können. Deshalb werden häufig unüberwachte oder halbüberwachte Lernmethoden eingesetzt, bei denen das Modell nur mit „normalen“ Daten trainiert wird und danach ungewöhnliche Daten als Anomalien identifiziert. Typische Verfahren sind statistische Methoden, Clustering, neuronale Netze oder spezielle Algorithmen wie Autoencoder und Isolation Forest. Anwendungsbeispiele finden sich in vielen Bereichen:
Durch den Einsatz von KI-gestützter Anomalie-Erkennung können Unternehmen schneller reagieren, Risiken minimieren und Kosten sparen. Allerdings sind die Algorithmen nur so gut wie die Trainingsdaten und benötigen oft eine sorgfältige Anpassung und Überwachung, um Fehlalarme zu reduzieren. Quellen:
| ||
API (Application Programming Interface)Eine API, kurz für „Application Programming Interface“ (Programmierschnittstelle), ist eine definierte Schnittstelle, über die Softwareanwendungen miteinander kommunizieren können. Sie stellt eine Sammlung von Funktionen, Protokollen und Definitionen bereit, die es ermöglichen, bestimmte Dienste, Daten oder Funktionen einer Anwendung oder eines Systems von einer anderen Anwendung aus anzusteuern oder zu nutzen – ohne dass dabei deren interne Implementierungsdetails bekannt sein müssen. APIs fördern damit die Interoperabilität und Modularität von Softwarelösungen und sind ein zentrales Element moderner Softwareentwicklung. APIs existieren in unterschiedlichen Formen, etwa als Betriebssystem-APIs (z. B. Windows API), als Bibliotheks-APIs oder als Web-APIs, die insbesondere in cloudbasierten und serviceorientierten Architekturen eine zentrale Rolle spielen. Letztere nutzen in der Regel standardisierte Kommunikationsprotokolle wie HTTP und Datenformate wie JSON oder XML, um über das Internet oder interne Netzwerke Daten zwischen Clients und Servern auszutauschen. Web-APIs sind insbesondere in RESTful- oder SOAP-Strukturen organisiert und ermöglichen beispielsweise den Zugriff auf Funktionen von Online-Plattformen wie Zahlungsdiensten, sozialen Netzwerken oder Wetterdiensten. Die Nutzung von APIs bringt zahlreiche Vorteile mit sich: Sie erleichtert die Integration externer Dienste, verkürzt Entwicklungszeiten und fördert die Wiederverwendbarkeit von Softwarekomponenten. Gleichzeitig stellt der Einsatz von APIs auch Anforderungen an Sicherheit und Datenschutz, etwa durch Authentifizierungsmechanismen (z. B. OAuth) oder Zugriffsbeschränkungen. APIs sind in der heutigen digitalen Welt nahezu allgegenwärtig – von mobilen Apps über Unternehmensanwendungen bis hin zum Internet der Dinge (IoT). Durch die gezielte Offenlegung von APIs können Unternehmen zudem sogenannte „Open APIs“ bereitstellen, die es externen Entwicklern ermöglichen, eigene Anwendungen auf Basis der bereitgestellten Schnittstellen zu entwickeln und so das eigene Ökosystem zu erweitern. Quelle: OpenAPI Initiative. (n.d.). What is an API?. https://www.openapis.org/what-is-an-api | |
C |
|---|
D |
|---|
Data-MiningData-Mining – Schatzsuche in den DatenbergenData-Mining bezeichnet den Prozess, in großen Datenmengen bisher unbekannte, aber potenziell wertvolle Muster, Zusammenhänge oder Trends zu entdecken. Der Begriff kommt ursprünglich aus dem Englischen und bedeutet wörtlich „Daten schürfen“ – vergleichbar mit dem Schürfen von Gold. In Zeiten von Big Data gewinnt Data-Mining zunehmend an Bedeutung, da Unternehmen immer mehr Daten speichern, deren Nutzen jedoch oft verborgen bleibt. Im Kern geht es beim Data-Mining nicht nur darum, Daten zu analysieren, sondern sie aktiv zu durchforsten, um daraus konkrete Handlungsempfehlungen oder Vorhersagen abzuleiten. Die klassische Datenanalyse folgt meist einer vorher definierten Hypothese (z. B. „Kaufen Kund:innen häufiger Produkt A oder B?“). Data-Mining hingegen ist explorativ: Es sucht Zusammenhänge, die man vorher nicht vermutet hat. Zu den bekanntesten Methoden des Data-Mining gehören Cluster-Analysen (Gruppierung ähnlicher Datenpunkte), Klassifikationen (Zuweisung von Daten zu vorher definierten Kategorien), Assoziationsanalysen (z. B. „Wenn jemand Produkt X kauft, kauft er oft auch Y“) oder Regressionsanalysen (Zusammenhänge zwischen Variablen erkennen). Auch neuronale Netze und Entscheidungsbäume sind typische Werkzeuge, insbesondere wenn es um Prognosen geht. Praktische Einsatzfelder sind vielfältig:
Ein zentrales Thema bei Data-Mining ist der Datenschutz. Oft werden sehr große Mengen personenbezogener Daten verarbeitet, was ethische und rechtliche Fragen aufwirft. Unternehmen müssen hier sorgfältig abwägen, welche Daten sie verwenden dürfen und wie sie Transparenz gegenüber Betroffenen schaffen. Zusammenfassend lässt sich sagen: Data-Mining ist eine Art digitale Schatzsuche, die enorme Chancen bietet – aber auch verantwortungsvoll durchgeführt werden muss. Wer es schafft, relevante Erkenntnisse aus dem Datenmeer zu fischen, verschafft sich einen echten Wettbewerbsvorteil. Gleichzeitig gilt: Nicht alles, was man finden kann, sollte auch genutzt werden. | |
E |
|---|
ERP-SystemeEin ERP-System (Enterprise Resource Planning) ist eine integrierte Softwarelösung, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Geschäftsprozesse zentral zu steuern, zu überwachen und zu optimieren. Ziel ist es, sämtliche betrieblichen Abläufe – wie Einkauf, Produktion, Lagerhaltung, Vertrieb, Personalwesen und Finanzbuchhaltung – in einem einheitlichen System abzubilden. Der große Vorteil eines ERP-Systems liegt in der gemeinsamen Datenbasis. Informationen werden nur einmal eingegeben und stehen dann allen Abteilungen in Echtzeit zur Verfügung. Das reduziert Fehler, spart Zeit und erleichtert die Zusammenarbeit im Unternehmen. Ein Beispiel: Wird im Einkauf eine Bestellung ausgelöst, aktualisiert das ERP automatisch die Lagerbestände, verbucht die Ausgabe im Finanzsystem und informiert den Vertrieb über den Lieferstatus – ohne dass zusätzliche Schnittstellen nötig sind. ERP-Systeme sind modular aufgebaut. Unternehmen können je nach Bedarf verschiedene Module aktivieren oder hinzukaufen – z. B. für Finanzbuchhaltung, Materialwirtschaft, Produktion, Kundenmanagement (CRM) oder Projektmanagement. Bekannte Anbieter solcher Systeme sind SAP, Microsoft Dynamics, Oracle und Sage. Die Einführung eines ERP-Systems erfordert eine sorgfältige Planung. Neben der technischen Umsetzung ist auch die Anpassung von Geschäftsprozessen notwendig, was oft mit einem erheblichen organisatorischen Wandel verbunden ist. Langfristig ermöglichen ERP-Systeme jedoch eine bessere Entscheidungsgrundlage, höhere Effizienz und mehr Transparenz im Unternehmen. Inzwischen setzen auch kleinere und mittlere Unternehmen auf ERP-Systeme, nicht zuletzt dank Cloud-Lösungen, die kostengünstiger und flexibler sind. Diese können ohne eigene IT-Infrastruktur genutzt werden und ermöglichen den Zugriff auf Unternehmensdaten auch mobil oder von verschiedenen Standorten aus. Fazit: [Text mit ChatGPT generiert] | |
F |
|---|
Forecasting/PrognosemodelleForecasting/PrognosemodellePräzise DefinitionForecasting, auch Prognosemodellierung genannt, beschreibt die Erstellung von Vorhersagen über zukünftige Entwicklungen basierend auf historischen Daten und statistischen oder KI-gestützten Methoden. Ziel ist es, Trends, Muster oder Abweichungen zu erkennen, um präzise Prognosen über geschäftsrelevante Kennzahlen wie Umsätze oder Nachfrageschwankungen zu treffen. KI-gestützte Prognosemodelle nutzen maschinelles Lernen, um komplexe Zusammenhänge in großen Datenmengen zu analysieren und genaue Vorhersagen zu generieren. Praktische AnwendungsbeispieleIn Unternehmen wird Forecasting vielfältig eingesetzt. Einzelhändler nutzen KI-Prognosemodelle, um Nachfrageschwankungen vorherzusagen, indem sie Verkaufsdaten mit externen Faktoren wie Wetter oder Feiertagen kombinieren, um Lagerbestände zu optimieren. In der Produktion unterstützen Prognosemodelle Predictive Maintenance, indem sie Maschinenausfälle anhand von Sensordaten vorhersagen, um Stillstandszeiten zu minimieren. Im Finanzbereich prognostizieren Organisationen Spendeneinnahmen, um Kampagnen strategisch zu planen und Ressourcen effizient einzusetzen. Abgrenzung zu traditionellen Methoden/ähnlichen BegriffenIm Vergleich zu traditionellen Methoden, die auf statischen Regeln oder manuellen Berechnungen basieren, passen sich KI-gestützte Prognosemodelle dynamisch an neue Daten an und erkennen komplexe, nicht-lineare Muster. Klassisches Forecasting verwendet oft einfache statistische Ansätze wie gleitende Durchschnitte, während KI-Modelle fortgeschrittene Algorithmen nutzen. Im Gegensatz zur Anomalieerkennung, die auf die Identifikation von Unregelmäßigkeiten abzielt, fokussiert Forecasting auf die Vorhersage zukünftiger Trends. Konkrete Tools/TechnologienHäufig genutzte Tools für Forecasting sind Tableau, RapidMiner und Microsoft Power BI, die integrierte Prognosefunktionen bieten und auch ohne tiefgehende Programmierkenntnisse einsetzbar sind. Google Looker unterstützt ebenfalls die Analyse und Visualisierung von Trends in komplexen Datenbeständen. QuellenangabeGrok (2025): Wissensdatenbank für KI-gestützte Datenanalyse, erstellt von xAI. | ||
H |
|---|
Heterogene DatenquellenDefinition: Beispiele für Heterogenität:
Anwendungsbeispiel:
Diese heterogenen Quellen müssen vereinheitlicht werden, um z. B. fundierte Auswertungen zum Gästeverhalten, zur Auslastung oder zur Wirkung von Marketingmaßnahmen vornehmen zu können. Bedeutung in der Praxis:
Hinweis: | ||
J |
|---|
J.A.R.V.I.SWas ist J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S. ist eine künstliche Intelligenz (KI) aus dem Marvel-Universum, vor allem bekannt aus den „Iron Man“-Filmen. Die Abkürzung steht für „Just A Rather Very Intelligent System“ (auf Deutsch: „Nur ein ziemlich intelligentes System“). Aktuelle Verwendung: Im Zusammenhang mit KI-Automatisierungs- und Assistenzsystem Definition: J.A.R.V.I.S. im Kontext moderner KI-AssistenzsystemeJ.A.R.V.I.S. – ursprünglich bekannt als „Just A Rather Very Intelligent System“ aus dem Marvel-Universum – steht heute sinnbildlich für eine neue Generation intelligenter Assistenzsysteme, die durch Fortschritte in Künstlicher Intelligenz (KI), Automatisierung und multimodaler Datenverarbeitung zunehmend Realität werden. Während J.A.R.V.I.S. in der Fiktion als persönlicher Assistent, Hausmanager und Kampfunterstützer agiert, beschreibt der Begriff in der heutigen Technologiewelt eine KI, die weit mehr kann als einfache Befehle ausführen: Sie interagiert auf Augenhöhe mit dem Menschen, versteht Sprache, Kontext und Absicht, und übernimmt eigenständig komplexe Aufgaben. Moderne J.A.R.V.I.S.-Interpretationen vereinen verschiedene technologische Komponenten: leistungsstarke Sprachmodelle wie GPT-4, autonome Agentensysteme, Robotergestützte Prozessautomatisierung (RPA) sowie visuelle Erkennungs- und Analysefähigkeiten. Diese Systeme sind in der Lage, Aufgaben zu planen, Datenquellen zu verknüpfen, Entscheidungen vorzubereiten und Tools direkt zu bedienen – etwa Kalender, E-Mail, CRM-Systeme oder Unternehmenssoftware. In Unternehmen wie im Alltag verändert diese Entwicklung die Mensch-Maschine-Interaktion grundlegend. Der Assistent wird zum proaktiven Copiloten, der personalisierte Vorschläge liefert, Routineprozesse automatisiert und in Echtzeit auf Veränderungen reagiert. Damit entwickelt sich J.A.R.V.I.S. zu einem Leitbild für die nächste Stufe digitaler Intelligenz: ein hybrides System aus Verständnis, Handlungskompetenz und technischer Integration, das den Menschen nicht ersetzt, sondern stärkt. In dieser modernen Lesart steht J.A.R.V.I.S. nicht nur für technische Innovation, sondern auch für ein neues Paradigma der Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine. Erstellt mit freundlicher Unterstützung von ChatGPT | |
Julius.ai🧠 Was ist Julius.ai?Julius.ai ist eine künstliche Intelligenz, die dir hilft, Daten (z. B. aus Excel oder CSV-Dateien) zu verstehen, zu analysieren und grafisch darzustellen, einfach indem du Fragen stellst – wie bei ChatGPT. 💡 Was kann Julius.ai für dich tun?
🧾 Wie funktioniert das in der Praxis?
🛠️ Für wen ist das nützlich?
📌 Fazit:
Quelle und Erzeugung durch ChatGPT | |
L |
|---|
LOOKERLooker ist eine professionelle Business-Intelligence- (BI) und Datenanalyse-Plattform, die zu Google Cloud gehört. Ihr Hauptzweck ist es, Unternehmen dabei zu helfen, ihre eigenen Daten zu verstehen, zu visualisieren und fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen. Es ist wichtig zu verstehen, dass Looker kein kreatives KI-Tool wie Midjourney oder ChatGPT ist, das neue Inhalte erschafft. Stattdessen nutzt es KI, um die Analyse von bestehenden Daten intelligenter und zugänglicher zu machen. Stell dir vor, ein Unternehmen sammelt riesige Mengen an Daten: Verkaufszahlen, Nutzerverhalten auf der Webseite, Lagerbestände und vieles mehr. Looker agiert als eine zentrale Brücke zu all diesen Datenquellen. Das Besondere daran ist die Modellierungsebene namens LookML. Hier definieren Datenanalysten einmalig, was Begriffe wie „Umsatz“ oder „aktiver Kunde“ bedeuten. Dieses einheitliche Modell stellt sicher, dass alle Mitarbeiter im Unternehmen mit denselben, korrekten Definitionen arbeiten – eine „einzige Quelle der Wahrheit“. Wo kommt nun die Künstliche Intelligenz (KI) ins Spiel? Looker integriert KI-Funktionen auf verschiedene Weisen, um den Analyseprozess zu unterstützen und zu automatisieren:
Zusammenfassend ist Looker also kein KI-Generator, sondern ein extrem leistungsfähiges Analyse-Werkzeug. Es nutzt KI, um Rohdaten in verständliche, interaktive und aussagekräftige Einblicke zu verwandeln und macht so komplexe Datenanalysen für ein breiteres Publikum im Unternehmen nutzbar. | |
